Die meisten Eltern starten als Paar. Nur rund zwei Prozent der frischgebackenen Mütter oder Väter beziehen ihr Elterngeld schon als Alleinerziehende. Mit der Zeit steigen die Zahlen aber deutlich an. Sara Buschmann ist Autorin, Vereinbarkeitsmanagerin, Mutter und Gründerin der Plattform Solomütter. Aus Erfahrung weiß sie: Trennungen kommen mal Knall auf Fall, mal schleichend, mal in gegenseitigem Einvernehmen und mal – mindestens für eine Person – völlig unerwartet.
Jede fünfte Familie ist die Familie eines alleinerziehenden Elternteils und acht von zehn alleinerziehenden Elternteilen sind Frauen. Die wenigsten haben sich diese Familienform aktiv ausgesucht, das Alleinerziehen ist den meisten im Laufe des Lebens irgendwann zugestoßen.
„Wusstest ihr, dass die Chance, ein alleinerziehender Elternteil zu werder, rund zehn Millionen Mal wahrscheinlicher ist, als mit einem Flugzeug abzustürzen? Wo sind dann aber die Security Advices für Eltern? Wo die Notausgänge mit Evakuierungsrutschen in die Solo-Elternschaft?“

Ziel von Sara Buschmann ist es, Alleinerziehende sichtbar zu machen, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen kritisch zu beleuchten und Eltern die Werkzeuge an die Hand zu geben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Gerade ist ihr erstes Werk erschienen: „Das Buch, das du vor dem Alleinerziehen gelesen haben musst“ (Komplett-Media). Dieses Sachbuch ist kein Angstmacher – sondern ein Überlebensratgeber für alle, die Eltern sind oder es werden.
Was heißt es heute alleinerziehend zu sein?
Alleinerziehende Familien sind so vielfältig wie alle anderen auch. In Deutschland gibt es rund 1,7 Millionen Alleinerziehende – und ihre Lebensrealitäten könnten unterschiedlicher kaum sein.
Offiziell gilt man als alleinerziehend, wenn man als einzige:r Erwachsene:r mit mindestens einem minderjährigen Kind in einem Haushalt lebt. Auf dieser Grundlage werden auch Steuerklasse II und bestimmte staatliche Leistungen berechnet.
Die Praxis sieht aber oft komplexer aus: Neben dem klassischen Residenzmodell, bei dem die Kinder überwiegend bei einem Elternteil leben (meist bei der Mutter), gibt es auch das Wechselmodell, in dem sich die Eltern die Betreuung etwa hälftig teilen. Dieses Modell wird aktuell von rund zehn Prozent gelebt.
Noch seltener ist das Nestmodell: Die Kinder bleiben in einer festen Wohnung, und die Eltern wechseln sich dort ab.
Du selbst musstest dich mit kleinem Baby in dieser Situation zurechtfinden. Was hättest du gern vorher gewusst?
Ich bin kein klassisches Beispiel, weil ich mit dem Vater meiner Tochter nicht verheiratet war. Aber gerade in langen Partnerschaften oder Ehen lohnt es sich, mögliche Trennungsszenarien frühzeitig zu durchdenken.
Was mich damals kalt erwischt hat, war die Wucht der Veränderungen: Eine Trennung mit Kind betrifft alle Lebensbereiche – von der beruflichen Vereinbarkeit über die Finanzen bis hin zum Alltag. Besonders herausfordernd war für mich, dass während meiner Elternzeit mein Arbeitsvertrag auslief.

Plötzlich stand ich mit Baby da und musste alles gleichzeitig neu regeln: Alltag, Betreuung, Job und Wohnung.
Gibt es Akut-Hilfen, die in Anspruch genommen werden können?
Ja, unbedingt – niemand muss eine Trennung oder den Verlust des Partners allein durchstehen. Es gibt zahlreiche Beratungsstellen und Expert:innen, zum Beispiel bei der Caritas, dem DRK oder dem Verband alleinerziehender Mütter und Väter, die oft kostenfrei unterstützen.
Ebenso wichtig ist es, sich Gleichgesinnte zu suchen: Menschen, die Ähnliches erlebt haben, verstehen die eigene Situation oft am besten und können enormen Halt geben. Außerdem empfehle ich immer eine gute Rechtsberatung – nicht, um Konflikte zu schüren, sondern um Klarheit über die eigenen Rechte zu haben.
Ich bin eine Verfechterin des Informationsvorsprungs – der schadet nie und gibt Sicherheit für die nächsten Schritte.
Welche staatlichen Hilfen wären für Alleinerziehende dringend notwendig?
Es gibt in Deutschland bereits einige gute Angebote und finanzielle Hilfen. Das Problem ist oft nicht ihr Bestehen, sondern ihre Zugänglichkeit. Viele Anträge sind so kompliziert, die Verfahren so kräftezehrend, dass Betroffene entmutigt aufgeben oder gar nicht erst beantragen. Unterstützung darf aber nicht an Bürokratie scheitern.
Darüber hinaus braucht es dringend Nachbesserungen im Detail. Ein Beispiel ist der Unterhaltsvorschuss: Er liegt immer noch unter dem gesetzlichen Mindestunterhalt – das ist eine klare Schieflage.

Auch das Ehegattensplitting gehört auf den Prüfstand. Statt Eheschließungen steuerlich zu belohnen, sollte unser System Familien mit Kindern fördern – unabhängig von der Lebensform der Eltern.
Frauen sind nach einer Trennung meist armutsbetroffen, welche Vorsorge ist in guten, gemeinsamen Zeiten einer Beziehung ratsam?
Es stimmt: Nach einer Scheidung oder Trennung geraten Frauen häufiger in finanzielle Schwierigkeiten als Männer. Statistisch haben alleinerziehende Mütter im Schnitt rund 500 Euro weniger im Monat zur Verfügung als Väter in derselben Situation.
Das liegt vor allem an strukturellen Faktoren: Frauen verdienen im Schnitt weniger, unterbrechen ihre Erwerbsbiografie häufiger für Kinder und übernehmen den größeren Teil der Care-Arbeit. Dazu kommt, dass sie wesentlich häufiger in Teilzeit arbeiten – mit allen Folgen für Gehalt, Karrierechancen und Rente.
Rund 41 Prozent aller alleinerziehenden Familien sind akut einkommensarm. Umso wichtiger ist es, in guten Zeiten vorzubeugen. Das bedeutet zum Beispiel als Paar offen über Finanzen zu sprechen, eigene Rücklagen zu bilden, Konten und Vermögen fair aufzuteilen, frühzeitig über Versicherungen und Testament nachzudenken und die gemeinsame Kinderbetreuung so zu gestalten, dass auch die Mutter abgesichert bleibt.
Solche Vorkehrungen schützen beide Partner:innen und schaffen Sicherheit für die Kinder.
Gerade zum Zeitpunkt der Familiengründung klafft die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern oft weit auseinander. Wie geht Familie trotzdem möglichst gleichberechtigt?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten, denn eine allgemeingültige Lösung gibt es nicht – jede Familie muss ihren eigenen Weg aushandeln. Entscheidend ist, dass beide Partner:innen bewusst eine faire Aufteilung suchen und nicht automatisch die Mutter durch Care-Arbeit in eine Abhängigkeit rutscht.
Wenn ein Elternteil in Teilzeit geht, kann ein finanzieller Ausgleich sinnvoll sein – zum Beispiel über ein Sparkonto, ein Depot oder eine Lebensversicherung. Solche Regelungen lassen sich auch vertraglich absichern, etwa über Eheverträge.
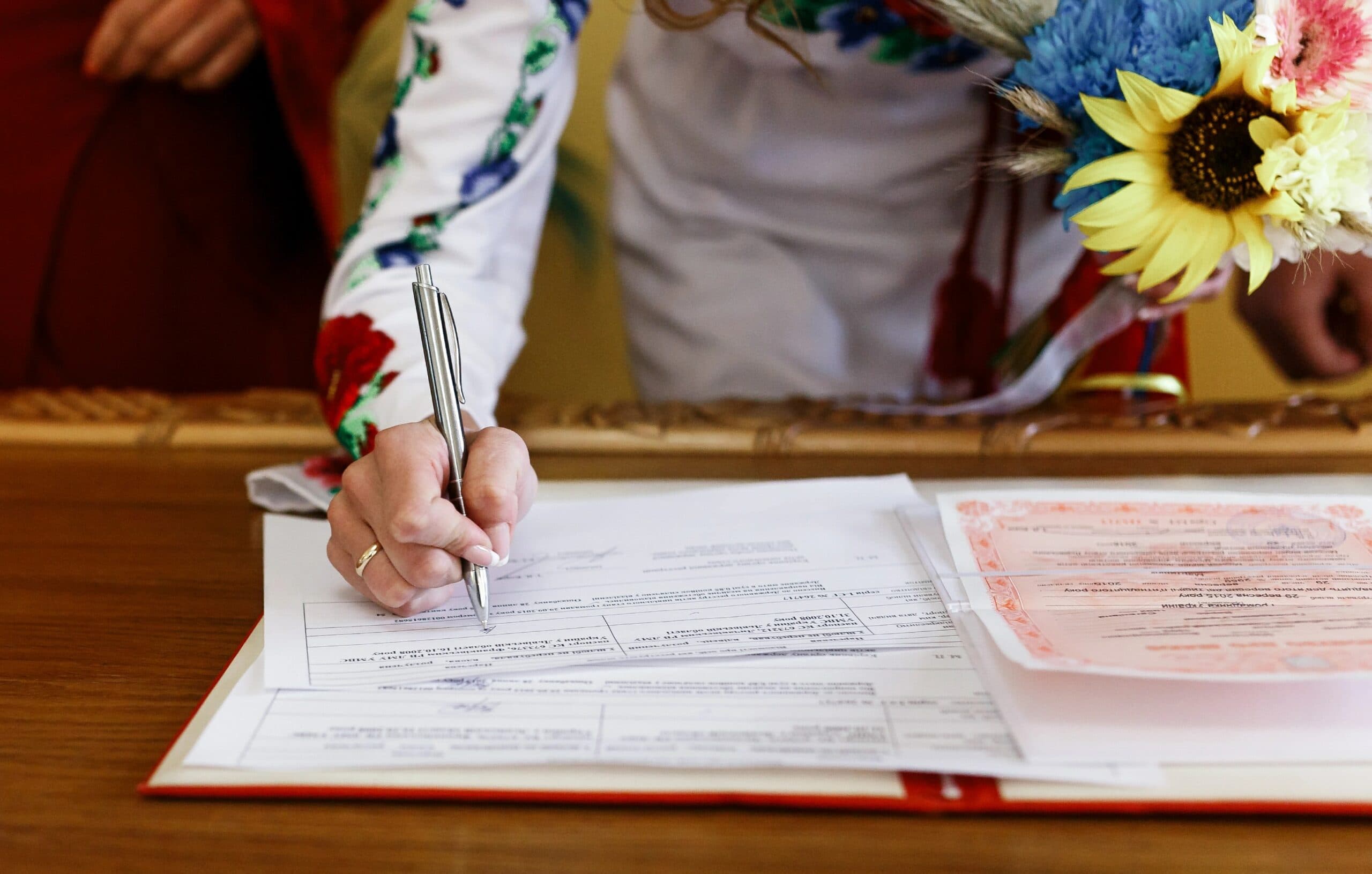
Hier rate ich aber auch immer: Checkt eure Eheverträge genau und macht keine Zugeständnisse, die ihr später bereut. Und auch wichtig: Einen Vertrag schließt ihr mit der Hochzeit in jedem Fall – entweder den, den der Staat für Eheleute vorsieht oder euren ganz persönlichen, den ihr individuell mit einem Rechtsbeistand erarbeitet.
Wie wirkt sich die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation auf den Kinderwunsch der Deutschen aus?
Immer mehr Menschen entscheiden sich in Deutschland gegen Kinder – und das hat viel mit den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zu tun.
Familien haben es hierzulande schwer, und das spiegelt sich in den Zahlen: Die Geburtenrate liegt derzeit bei nur etwa 1,35 Kindern pro Frau, so niedrig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Zugleich sind Menschen mit Kindern mittlerweile eine Minderheit – weniger als die Hälfte der Bevölkerung lebt in Haushalten mit Kindern.
Das bedeutet auch: Politische Entscheidungen werden zunehmend von Menschen geprägt, die selbst keine Kinder großziehen.

Besonders deutlich wird das an der Zusammensetzung des Bundestags: Nur rund ein Drittel der Abgeordneten sind Frauen. Das sind nochmal weniger weibliche Abgeordnete als in der vergangenen Legislatur.
Eine schlechte Entwicklung, wie ich finde, weil eine wichtige Perspektive fehlt – nicht zuletzt wenn über Familienpolitik entschieden wird. Nur wer politisch mitmischt, kann Themen durchsetzen und vorantreiben. Gerade wir Frauen sollten in aktuellen Zeiten sehr genau hinschauen, was die Politik uns „verkauft“: Familienfreundlich heißt nämlich nicht immer auch frauen- oder mütterfreundlich.
Viele Frauen definieren sich eher über ihre Mutterrolle anstatt über ihre Haltung oder ihren Beruf. Was ist der »Gender Confidence Gap«?
Der Begriff beschreibt die Lücke im beruflichen Selbstbewusstsein zwischen Männern und Frauen. Studien zeigen: Frauen trauen sich oft weniger zu, bewerben sich seltener auf Jobs, wenn sie nicht alle Anforderungen erfüllen, und fordern in Gehaltsverhandlungen weniger ein.
Im Gegensatz dazu präsentieren Männer sich selbstbewusster – auch wenn ihre Qualifikation objektiv nicht höher ist. Hinzu kommt, dass Frauen in Bewerbungsgesprächen häufiger persönliche Fragen gestellt bekommen, aber weniger Redezeit haben.
Kurz gesagt: Der Gender Confidence Gap zeigt, dass Frauen sich selbst oft zu klein machen. Wir dürften dicker auftragen, uns mehr zutrauen und sollten dementsprechend auch mehr fordern.
Wie erklärst du dir das aktuelle TradWife-Phänomen und was rätst du jungen Müttern diesbezüglich?
Das TradWife-Phänomen, das wir vor allem in sozialen Medien sehen, ist mehr als die romantisierte Darstellung einer „klassischen Hausfrau“. Hinter vielen dieser Accounts stehen evangelikale Strukturen oder rechtes Gedankengut.
Die Botschaft ist klar: Frauen sollen sich wieder ausschließlich um Heim und Herd kümmern, während Männer die Kontrolle über Geld und Entscheidungen haben. Das ist gefährlich, weil es Frauen in Abhängigkeit drängt – finanziell wie persönlich.
Mein Rat an junge Mütter: Wählt eure Vorbilder bewusst und lasst euch nicht von vermeintlich perfekten Über-Müttern blenden, die alles „from scratch“ selbst machen.
Bei vielen TradWife-Influencerinnen ist die Inszenierung Teil ihres Geschäftsmodells – sie verdienen Geld mit ihren Kanälen. Wer ihnen im echten Leben nacheifert, riskiert dagegen, in die alte Falle der Abhängigkeit zu tappen. Wirkliche Selbstbestimmung heißt, die eigene Rolle frei zu wählen – und nicht in ein rückwärtsgewandtes Ideal hineinzurutschen, das anderen nützt, aber euch selbst langfristig schadet.
Alleinerziehende:r Mutter:Vater sein, ein glückliches Familienleben führen und ein erfülltes sowie finanziell sicheres Berufsleben haben – geht das?
Vereinbarkeit funktioniert für Alleinerziehende grundsätzlich so gut oder schlecht wie in anderen Familien auch – nur zugegebenermaßen unter erschwerten Bedingungen: weniger Geld, mehr Organisation und Mental Load und leider auch mehr gesellschaftliche Hürden bis hin zur Diskriminierung.

Trotzdem sage ich immer: Alles ist besser, als in einer unglücklichen Partnerschaft zu verharren, nur aus Angst vor dem Alleinerziehen. Wir haben nur dieses eine Leben – und das sollten wir möglichst selbstbestimmt und unabhängig leben, ob innerhalb oder außerhalb einer Partnerschaft.
Meine klare Botschaft: Habt keine Angst vor dem Alleinerziehen. Es ist anders, aber nicht schlechter. Und von dem „You can have it all“-Gedanken habe ich mich verabschiedet. Mit Kindern kann man nicht alles gleichzeitig haben, das Leben ist voller Kompromisse. Wer alles auf einmal will, riskiert Burnout.
Besser ist: Prioritäten setzen, sich auf das Wesentliche konzentrieren und das Beste aus der eigenen Situation machen.
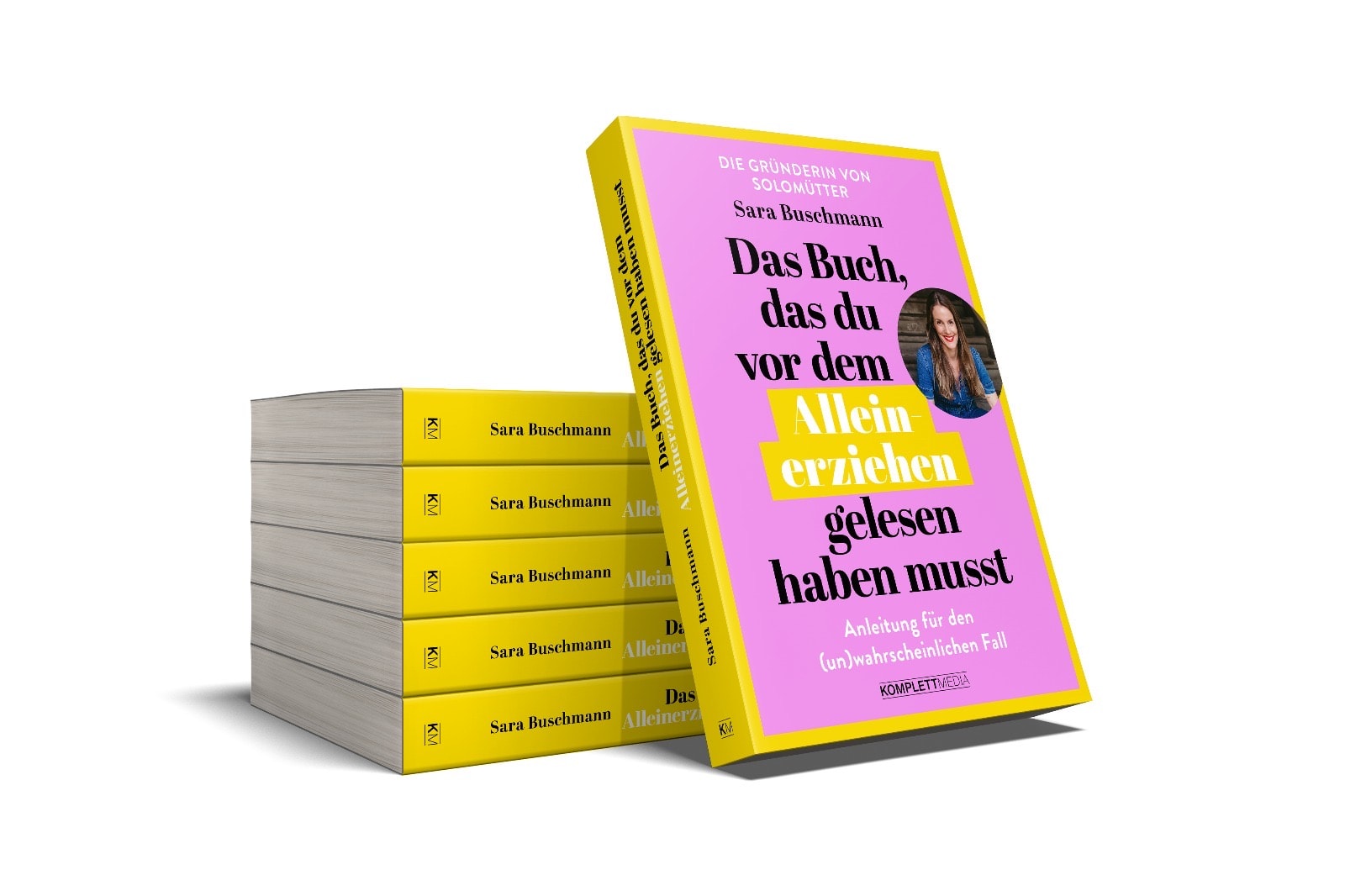
Ein Überlebensratgeber für alle, die Eltern sind oder es werden. „Das Buch, das du vor dem Alleinerziehen gelesen haben musst.“
240 Seiten, Komplett-Media, 03.09.2025, 24 Euro, ISBN: 978-3-8312-0649-0
